Aktuelles
Pressemitteilung: Abschlusskonferenz in Göttingen – Weichenstellung für die Zukunft von Kiefernwäldern und deren Wertschöpfung in Norddeutschland

Im Mittelpunkt der Tagung stand die lückenlose Untersuchung der Wertschöpfungskette von Kiefern(stark)holz in Norddeutschland. In die Forschungsarbeiten wurden rund 80 % der bundesweiten Kiefernwaldflächen einbezogen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der erwarteten Anpassungsfähigkeit der Kiefer sowie des anstehenden Umbaus von Reinbeständen zu „klimafitten“ Wäldern gilt es, das Potenzial des enorm steigenden Angebots an starkem Kiefernholz möglichst umfassend und innovativ zu nutzen.
Das Projekt „Nachhaltige Nutzungspotenziale für Kiefernstarkholz“ (KiefernStolz) wurde mit rund 1 Mio. € aus dem Waldklimafonds gefördert und im Wilhelm-Klauditz-Institut der Fraunhofer-Gesellschaft, in der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt und an drei Lehrstühlen der Georg-August-Universität Göttingen bearbeitet. Ziel des Projektes war es, Chancen und Risiken aufzuzeigen, sowie Strategien zu entwickeln, die eine effiziente Nutzung des künftig steigenden Marktanteils von Kiefernholz ermöglichen.
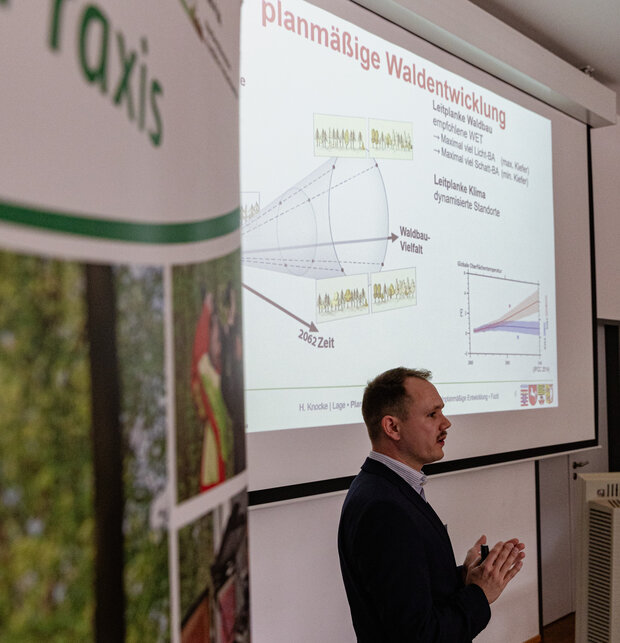
Ein zentrales Thema der Tagung war die innovative Produktion und Verwertung von Starkholz. Dies umfasst die gesamte Wertschöpfungskette und beginnt bei differenzierten und risikomindernden Waldbauverfahren mit Überhältern, die künftige Mischungsziele und betriebswirtschaftliche Aspekte gleichermaßen berücksichtigen. Die Holzernte in Kiefernwäldern birgt aufgrund von Wuchseigenschaften (Hangrichtung) und dem Einbringen von Mischbaumarten Herausforderungen, die durch eine intensivere Feinerschließung und kombinierte Holzernteverfahren pfleglich, ergonomisch und ökonomisch vorteilhaft gelöst werden können. Auf der Verarbeitungsseite wurden vielfältige Verwendungsmöglichkeiten für starkes Kiefernholz identifiziert und teils innovative Produktideen entwickelt, die ihre Holzeigenschaften ganz gezielt berücksichtigen. Ein entscheidender Faktor für die Verwendung ist der Harzanteil, dem durch Trennung von Splint- und Kernholz Rechnung getragen werden kann. Besonders wertvoll ist das festere und harzärmere Splintholz des unteren Stammstückes, dessen Anteil in Starkholzsortimenten zunimmt und eine kundenspezifische Trennung im Sinne einer hohen Wertschöpfung rechtfertigt. Lösungen dafür könnten in einem optimierten Holzeinschnitt im Sägewerk, wo „das Runde ins Eckige“ muss, liegen. Noch effizienter kann eine Verarbeitung zu Furnier – Stichwort „das Runde ins Flache“ – sein. Hier werden noch weniger Koppelprodukte erzeugt und dank neuartiger, hochfester Verleimungstechnologien können Schälfurniere als mehrlagige Verbundwerkstoffe zu Formteilen oder tragenden Werkstoffen verarbeitet werden. Deren Materialeigenschaften sind gegenüber Vollholz homogener und zeigen überlegene Festigkeitseigenschaften.
Das Fazit der Konferenz ist eindeutig: „Wenn Starkholz, dann richtig!“ Entlang der gesamten Wertschöpfungskette bedarf es dafür adaptiver Ansätze: Forstseitig sind dies auf unterschiedliche Ausgangssituationen angepasste waldbaulich-technische Verfahren, vor allem aber ein früherer Fokus auf die Ernte als bisher. Holzseitig ist dies eine größere „Rohstoffoffenheit“, welche die Besonderheiten des Kiefernholzes akzeptiert und bestenfalls sogar zusätzlich in Wert setzt. So kann es gelingen, das mittelfristig massiv wachsende Potenzial an Kiefernstarkholz sicher zu ernten und innovativ zu verwerten. Angesichts des Klimawandels, der zunehmenden Knappheit an Fichtenholz, sowie weiter steigender Anteile hiebs- und vorratsreicher Kiefernwälder drängt die Zeit. „Es ist fünf vor zwölf“, um Norddeutschlands Kiefernwälder klimafit zu machen und ihre wertvolle Ressource hierzulande optimal zu nutzen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Projektseite der NW-FVA oder der Universität Göttingen.
Das Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) im Rahmen der Förderrichtlinie des Waldklimafonds gefördert.
